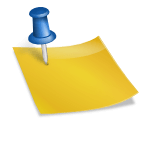Ahnenforschung in Thüringen
Wo fange ich mit der Suche an?
Die Frage stellt sich wohl jeder erst einmal. Und es gibt hierfür sogar ein Rezept, das man nicht nur im Gothaer Land, in Thüringen, sondern mehr oder weniger in ganz Deutschland anwenden kann. Viele Blogs, Websites oder Fachbücher widmen sich mit diesem Thema und bei so ziemlich jedem wird man folgende Reihenfolge feststellen und sicherlich noch detailiertere Informationen bekommen. Eines ist jedoch wichtig: Genealogie ist ein Präzisions-Hobby! Und man benötigt einen langen Atem.
Zu Hause
… finden sich mitunter erste wichtige Dokumente wie Geburtsurkunden, Ahnentafeln, Familienfotos, Tagebücher sowie Verwandte wie Oma Liesbeth und Onkel Heinz.
Das Standesamt
… ist immer die nächste Adresse für einen Ahnenforscher. Ab 1876 wurden standesamtliche Register im ganzen Reichsgebiet verpflichtend eingeführt und bis in die heutige Zeit fortgeführt. Natürlich kann man dort aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht alle Akten einsehen. Man muß schon ein berechtigtes Interesse vorweisen können und teilweise auch eine direkte Verwandschaft nachweisen. Auch werden aus o.g. Gründen Sperrfristen eingehalten. Ausserdem sollte man schon wissen, wen man in welchem Jahr sucht, sonst wird es langwierig und damit teuer.
Das Internet
…weiß alles. Möchte man jedenfalls meinen.
Spätestens jetzt kommt nämlich ein Punkt, an dem ein Anfänger leicht ins Grübeln kommt und sich hilfesuchend umschaut. Die damalige Schrift ist schon etwas anders als die heutige. Sütterlin, Kanzleischrift und Kurrent sind nun angesagt, das beherrscht heute nicht mehr jeder. Da ist guter Rat teuer, aber wofür gibt es schließlich das Internet. Jedoch auch Google, MyHeritage, Ancestry & Co. können das (bisher) nicht lesen, sondern warten nur mit den Millionen eingescanter Daten auf. Und die haben einige viele (zahlende) Mitglieder vielleicht schon „transcribiert“, also in heute lesbare Schrift umgesetzt. Das ist dann eher ein Glücksfall.
Der genealogische Verein
… war schon vor dem Internet da und ist manchmal schon über hundert Jahre „am Markt“. Es gibt in Deutschland gut 70 solcher Vereine, die im Dachverband DAGV organisiert sind. Einer davon sind wir, die Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e.V. (AGT). In fast allen Regionen Thüringens haben sich regionale Forschergruppen (z.B. der „Genealogische Abend „Gothaer und Eisenacher Land“) gebildet, um sich in regelmässigen Abständen auszutauschen. Hier findet man kompetente Ansprechpartner für die Region und die Familien, die dort einst wohnten.
Das Staatsarchiv
Nach einer gewissen Zeit werden Akten dem zuständigen Staatsarchiv angeboten, dass dann die als archivierungswürdig befundenen Unterlagen aufnimmt. Hier ist also unsere nächste Adresse für die Suche, z.B. das Thüringer Staatsarchiv Gotha. Auch hier gelten ggf. noch die gesetzlichen Sperrfristen für einzelne Unterlagen. Und auch hier sollte man ungefähr wissen wann man wen und was sucht. Manchmal steckt der Teufel übrigens im Detail und hierfür ist dann ein wenig Kenntnis der Regionalhistorie von Nöten. Archive arbeiten nach dem Provinienzprinzip, d.h. sie werden dort archiviert, wo die Akten ursprünglich entstanden sind. So war Seebergen bis 1825 eine Exklave des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt und gehörte dann bis zur Gründung der Weimarer Republik zum Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha. Hier muss man sich also sowohl in Gotha als auch in Rudolstadt umschauen. Thüringen hat übrigens ein wunderbares Archivportal, dass für die Vorbereitung des Archivbesuches Gold wert ist.
Die Pfarrämter
Vielfach stellen die Pfarrämter die einzige Möglichkeit dar, vorstandesamtliche Quellen wie Kirchenbücher auszuwerten. Nicht alle Kirchenbücher sind beim Ev. Landeskirchenarchiv Eisenach oder bei FamilySearch (aka LDS-Kirche aka Mormonen) einsehbar.
Die Pfarrämter in Thüringen sind Familienforschern an sich wohlgesonnen, wenn man einmal von ganz wenigen Ausnahmen absieht. Grundsätzlich ist aber vom Forscher ein gewisses Verständnis für die vielfältigen Aufgaben eines Pfarramtes aufzubringen: Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus. Die Bearbeitung von Forscheranfragen steht nun einmal ganz hinten auf der seelsorgerischen Prioritätenliste. Hier heisst es vor allem Geduld zu beweisen. Die können wir uns im Gegensatz zu Berufsgenealogen und Erbenermittlern aber durchaus leisten, schließlich sind die Objekte unserer Begierde längst verblichen und es geht uns nicht um den kommerziellen Erfolg.
Durch sinkende Mitgliederzahlen in den Pfarrgemeinden sind heute Zusammenschlüsse zu Gemeindeverbänden, die Abstufung zu Filialgemeinden oder sogar Auflösungen an der Tagesordnung. Teilweise werden von einem Pfarrer sechs oder sieben Gemeinden betreut. Hier wird es dann aus zweierlei Hinsicht für den Forscher schwierig: die Pfarrämter haben noch weniger Zeit für unser Anliegen und es stellt sich teilweise die Frage, wo derzeit überhaupt die Kirchenbücher lagern.
Schriftliche Anfrage oder Ortstermin?
Wer einen weiten Anfahrtweg hat, dem stellt sich die Frage meisst erst gar nicht. Man muß sich dann nur dessen bewußt sein, dass eine Antwort u.U. einige Wochen auf sich warten lässt oder im schlimmsten Fall sogar unbeantwortet bleibt.
Vielfach hat es sich als günstiger erwiesen, bei den Pfarrämtern nach Terminen zu fragen. Auch hier kann so mancher Versuch ins Leere laufen, da die Pfarrämter teilweise nur stundenweise an wenigen Tagen in der Woche besetzt sind. Selbst wenn dann ein Termin vereinbart wurde, heisst das noch lange nicht, dass er auch wirklich zustande kommt, denn die seelsorgerische Arbeit geht nun einmal vor.
Vorbereitung ist das A und O
Ist der nun endlich Termin vereinbart, sollte man sich gut vorbereiten. Vielfach hat man vor Ort nur ein paar Stunden (vielleicht einen halben Vormittag) Zeit, um der Forschung nachzugehen. Also sollten Sie sich eine Prioritätenliste anfertigen. Eine komplette Ahnenliste von mehreren hundert Seiten ist da sicher nicht angebracht. Machen Sie sich mit den vor Ort befindlichen Quellen vertraut. Hier helfen Kirchenbuchverzeichnisse wie der „Güldenapfel“, der allerdings bereits vor dem 2. Weltkrieg erschien und u. U. noch Quellen gelistet hat, die heute leider nicht mehr aufzufinden sind. Hier finden Sie auch Hinweise zu ggf. Einpfarrung des gesuchten Ortes.
Neben den heute allgemein üblichen Laptops, Tablets & Co. ist herkömmliches Schreibmaterial wie Papier und Bleistift (Kugelschreiber etc. sind tabu!) einzuplanen, um sich zwischenzeitlich Notizen (bitte nicht in den Kirchenbüchern, wir kennen da zahlreiche Beispiele) zu machen.
Für den eher seltenen Fall, dass Sie Fotos von den Kirchenbucheinträgen machen dürfen nehmen Sie eine gute Kamera mit lichtstarkem Objektiv und ein Stativ mit. Mit Tablets oder Mobiltelefonen kann man das Fotografieren in Räumen meisstens vergessen, vor allem, da auch der Blitz tabu ist. Sie ärgern sich hinterher nur über die miesen Ergebnisse.
Eine Buchstütze ist auch von Vorteil, wie sie meisstens auf dem Altar liegt. Diese bitte nicht benutzen, ich denke allein die Frage danach wäre einen Rauswurf wert. Denken Sie an eine zweite Speicherkarte und an einen Ersatzakku für Kamera und ggf. das Laptop. Eine Steckdose wird Ihnen nicht unbedingt zur Verfügung stehen.
Fahren Sie vorher in den Baumarkt und besorgen sich für 6-7 € ein Paar weisse Handschuhe. Diese sollten Sie dann auch für das Blättern in den Kirchenbüchern benutzen, nicht nur weil das professioneller aussieht. Vor allem dient die Benutzung von Handschuhen dem Schutz der Kirchenbücher.
Natürlich muß man sich auch um das eigene leibliche Wohl Gedanken machen, aber nur vor und nach dem Termin. Essen und Trinken sollte man beim Forschen tunlichst unterlassen, auch wenn ich selbst schon einmal eine Kanne Kaffee neben dem Kirchenbuch kredenzt bekommen habe. Erwarten Sie auch nicht, dass Sie die sanitären Anlagen benutzen können. Also möglichst alles vor- oder nachher erledigen.
Im Pfarramt
Hat man es endlich geschafft, im Pfarramt oder Gemeindehaus zu sitzen, ist die Quellenkunde vor Ort ein erster Schritt. Was ist überhaupt noch da? Und auch sehr wichtig, sind das die Originale oder nur die Duplikate? Geben Sie an, welche Kirchenbücher Sie einsehen möchten und fangen Sie bei der Ahnenforschung mit den neuesten Büchern an. Bei der Nachfahrenforschung eben genau anders herum, bei einer geplanten Verkartung brauchen Sie wohl ein paar Termine mehr. Nehmen Sie sich dabei nicht zu viele Bücher vor und vermeiden Sie es möglichst, in mehr als einem Buch zu blättern.
Jetzt aber endlich forschen!
Haben Sie etwas gefunden, schreiben Sie sich den Buchtitel, die Seite und die Eintragsnummer auf. Das gilt auch dann, wenn Sie Fotos machen dürfen. Können Sie etwas nicht eindeutig lesen und dürfen nicht fotografieren, versuchen Sie den Eintrag möglichst detailliert abzuzeichen.
Nehmen Sie alle Pateneinträge auf, obwohl diese meiner Erfahrung nach vor 1800 keine allzu große verwandschaftliche Bedeutung beizumessen ist, es sei denn, die Paten kamen aus anderen Orten. Wichtig sind die Pateneinträge, bei denen die gesuchten Personen selbst als Paten genannt werden. Hier wird dann häufig auch noch die derzeitige Ehegattin, der Beruf oder ein Amt und ggf. das Verwandschaftsverhältnis zum Täufling oder dessen Eltern genannt. Zumindest ist es immer ein Lebenszeichen.
Hanß Müller oder was?
Die ältesten Kirchenbücher beginnen vielfach erst nach dem 30-jährigen Krieg. In der Zeit war die Vielfalt der Vornamen nicht gerade ausgeprägt. So hat man sich zur Unterscheidung gewisser Prä- und Suffixe (maj., med. jun., min. sen., d. Ä., der junge etc.) oder Alias-Namen (Meier gen. Müller) bedient. Diese sind immens wichtig, da eine Zuordnung der 10 verschiedenen Hanß Müller fast nur so möglich ist. Sollten Sie in die Verlegenheit kommen, auf einen dieser Anhängsel zu stoßen, nehmen sie am Besten alle gleichnamigen Personen im Kirchenbuch auf. Es war durchaus üblich, dass bei Tod oder Wegzug eines „sen.“ der nächstältere Hanß Müller dieses Suffix erbte. Zog dann noch ein Hanß Müller dazu, war dieser dann ggf. „Hanß Müller med.“ In diesen Fällen empfielt es sich außerordentlich, weitere Quellen wie die Kirchenbücher umliegender Dörfer oder Steuerlisten, Lehn- und Gerichtshandelsbücher zu konsultieren.
Immer gut ist es im Kreis der Forscher zu fragen, wer in dem betreffenden Ort bereits geforscht hat oder zum betreffenden Pfarramt ein besonderes Vertrauensverhältnis aufgebaut hat.
Regionale Forschertreffen
Besuchen Sie doch eines unserer Forschertreffen:
[events_list]